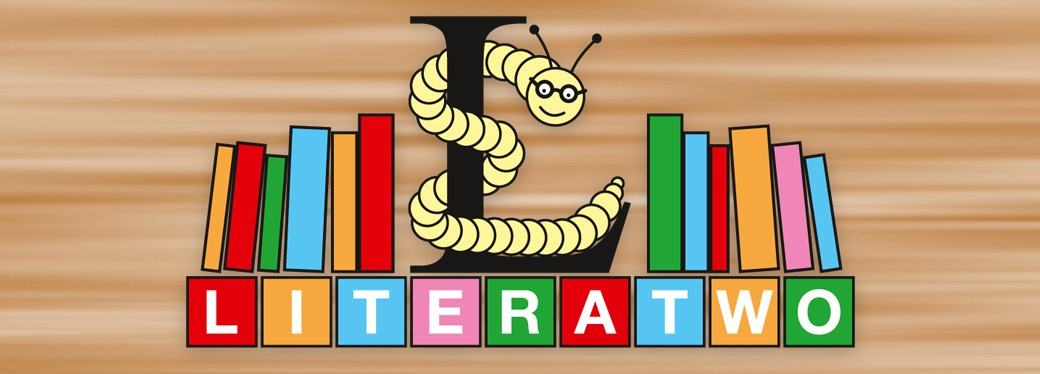Zwei Worte, die mich im Buch auf jeder Seite begleiten, genau wie der Titel, der schon innehalten lässt, bevor man das Buch überhaupt aufschlägt, bevor man nur annähernd weiß, worum es geht.
Sie ist es, die ausbricht.
Sie ist es, die umherirrt.
Sie ist es, die nicht ankommt.
Sie ist es, die lieben will, aber nicht liebt.
Sie ist es, die sich anlehnen will, sich aber nicht anlehnt. Sie ist es, die gern eine Familie hätte, aber nur eine Patchworkfamilie hat.
Sie ist es, die gern ein anderes Leben hätte, was sie nicht bekommt.
Sie ist pessimistisch und verwandelt sich immer mehr in noch tieferen Pessimismus.
Sie hätte gern ein Ziel, findet aber keins.
Sie wäre gern diejenige, von denen sie behauptet, ebendiese zu sein.
Sie ist gefangen im Kopfgefängnis und jeder Ausbruch bleibt ein Versuch, weil er kein richtiger Ausbruch sein soll.
Sie hat Gedanken, die nicht ans Anhalten denken, die nicht anhalten sollen, auch wenn es noch so wichtig wäre.
Sie malt sich Bilder voller Hass, die sich bewahrheiten und sich doch nicht bewahrheiten sollen.
Sie denkt rassistisch und politisch und dann doch wieder ganz anders.
Sie lebt in der Realität und gleitet doch durch die Fiktion.
Sie lebt ihre Fantasie, die eigentlich nicht diese Fantasie sein soll, in sich selbst aus.
Sie sucht ein Ende, in dem es endgültig sein soll, wobei sie dabei den unbegonnenen Anfang ersehnt.
Sie. Rot. Kopfgefängnis.
Die Autorin Antonia Baum lässt mich gleich im Kapitel vor dem ersten Kapitel inne halten. Genau das ist es, was ein Buch auszeichnet. Stopp. Anhalten. Zurück. Nochmal lesen und verinnerlichen. Dann ins erste Kapitel einsteigen und auf ihre Protagonistin treffen, die wahrlich keine Freude am Leben hat. Ein Tapetenwechsel hat sie in diese Stadt getrieben, anders sollte es werden. Sie ist jung und hat ein Leben, auf das sie nicht schauen möchte. Raus hieß das Ziel, heißt das Ziel. Das Umfeld ist nicht gut für sie, ihre Familie ist nicht so, wie sie hätte sein können und ihr Freund ist das personifizierte Unglück. Von der Liebe ganz zu schweigen und vom Glück ebenso.
Umgeben von Ketten, steht die Frau, die noch junge Frau, vor der Tür des Lebens, was gelebt werden will, aber scheinbar nicht gelebt werden kann. Sie ist kühl, ein Kontakt zu ihr scheint unmöglich, sie ist nicht greifbar und bleibt entfernt. Jedes Wort, was etwas über die Protagonistin aussagt, muss gefunden werden, gesucht werden und dann klammert man sich an eben dieses Wort. Diese Umklammerung wird von Seite zu Seite kraftloser. Ob man als Leser schreit, helfen will, verzweifelt im Handlungsverlauf, alles ist egal. Sie bleibt entfernt und genau das ist der Grund, warum ich an ihrer Seite bleibe und doch nicht an ihrer Seite bin.
Die Autorin spielt mit ihren Worten eine reine Diashow im Buch ab, eine Diashow, die vollkommen leblos, bestenfalls tot ist. In ausladenden Bildern gibt sie dem Leser keine Möglichkeit die Diashow bunter zu gestalten, die Farbpalette bleibt in dunklen Tönen und muss so angenommen werden. Lange Schachtelsätze mit vielen Wortwiederholungen führen eine Tiefgründigkeit mit allerlei Untiefen herbei, die zum Anhalten führen, ein Weiterlesen ist stellenweise nicht möglich. Zu bewegend sind die Worte, das Reflektieren auf sich selbst ist zu übermächtig und doch ist es stellenweise einfach nur die Leere, die man verarbeitet. Nachvollziehbar, teils amüsant, aber auch niederschmetternd.
Die Erzählkunst, die depressive, hasserfüllte und auch horrormäßige, ist beeindruckend, aber auch bitter und unerträglich. Ein Buch, was keinesfalls zartbesaitete oder lebensunlustige Menschen lesen sollten, ein Buch, was vollkommen leblos, bestenfalls tot ist und doch das Gegenteil vom Besagten. Die Sprache ist einmalig, die Stimmung, in die es den Leser zieht, ist ungewöhnlich und bringt die Gefühle, die erst ruhen wie ein See, in ein wellendes Meer.
Einige Wellen sind mir persönlich zu stark übergeschwappt, diese hätte ich gern flacher entgegen genommen, aber es ist wie es ist „vollkommen leblos, bestenfalls tot“.